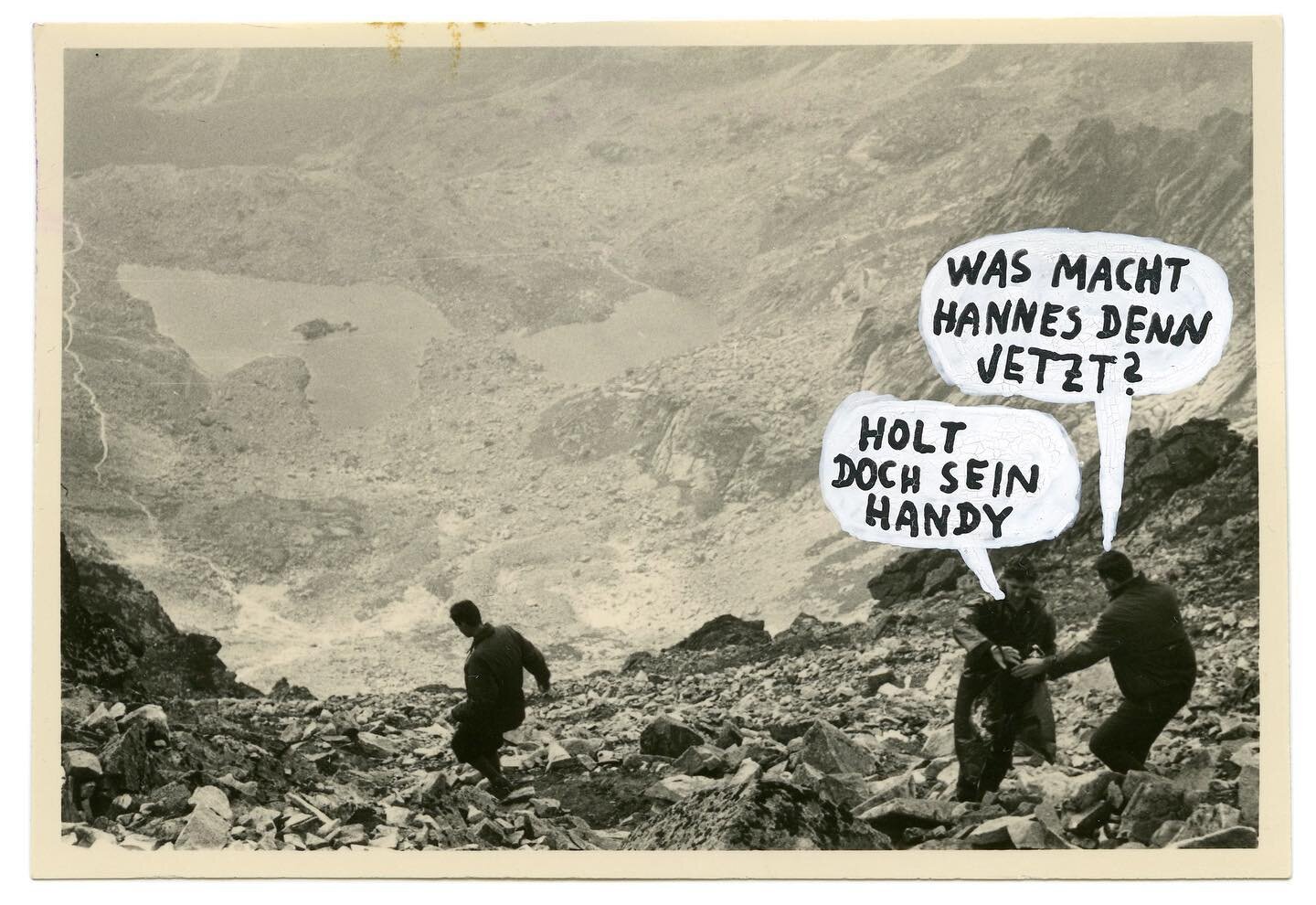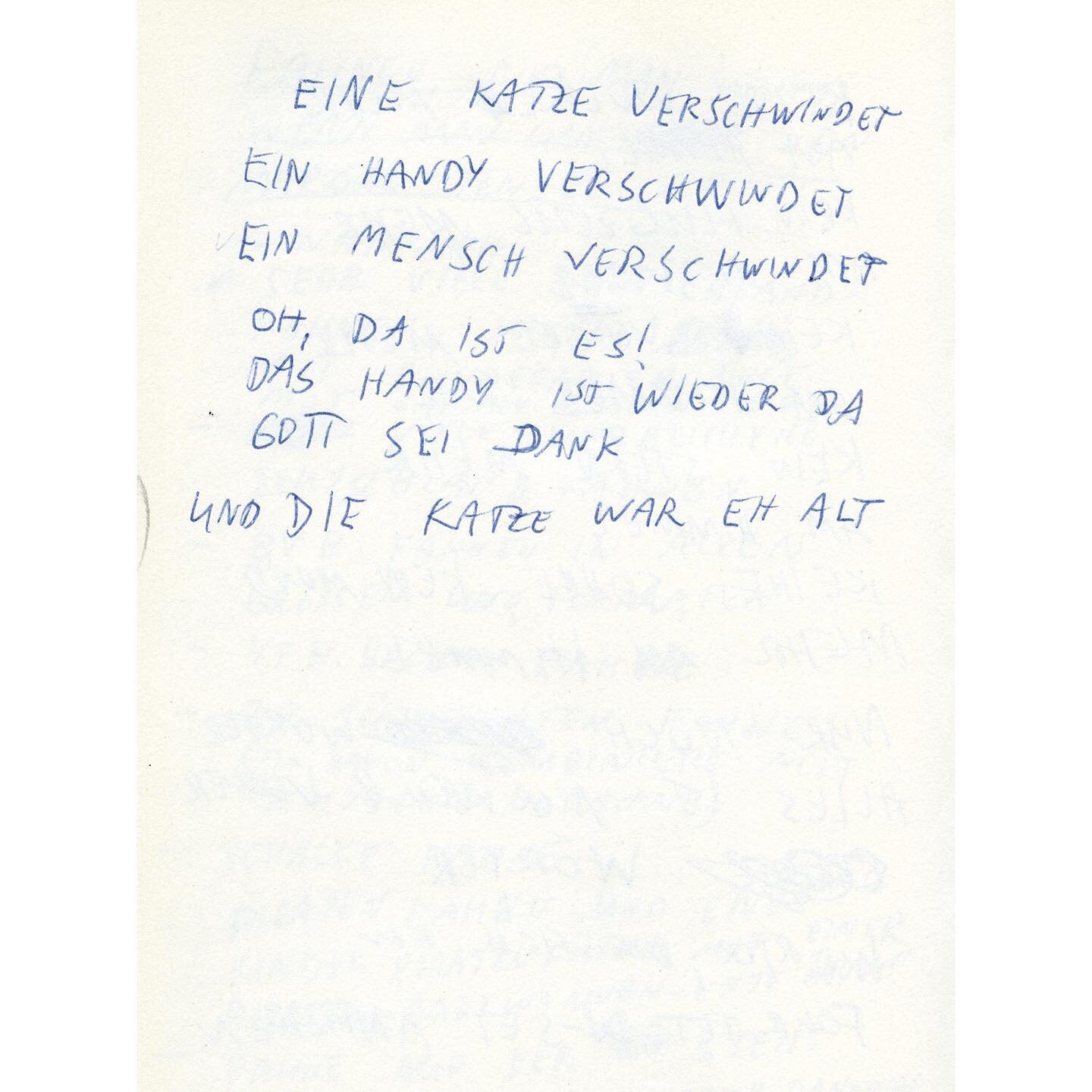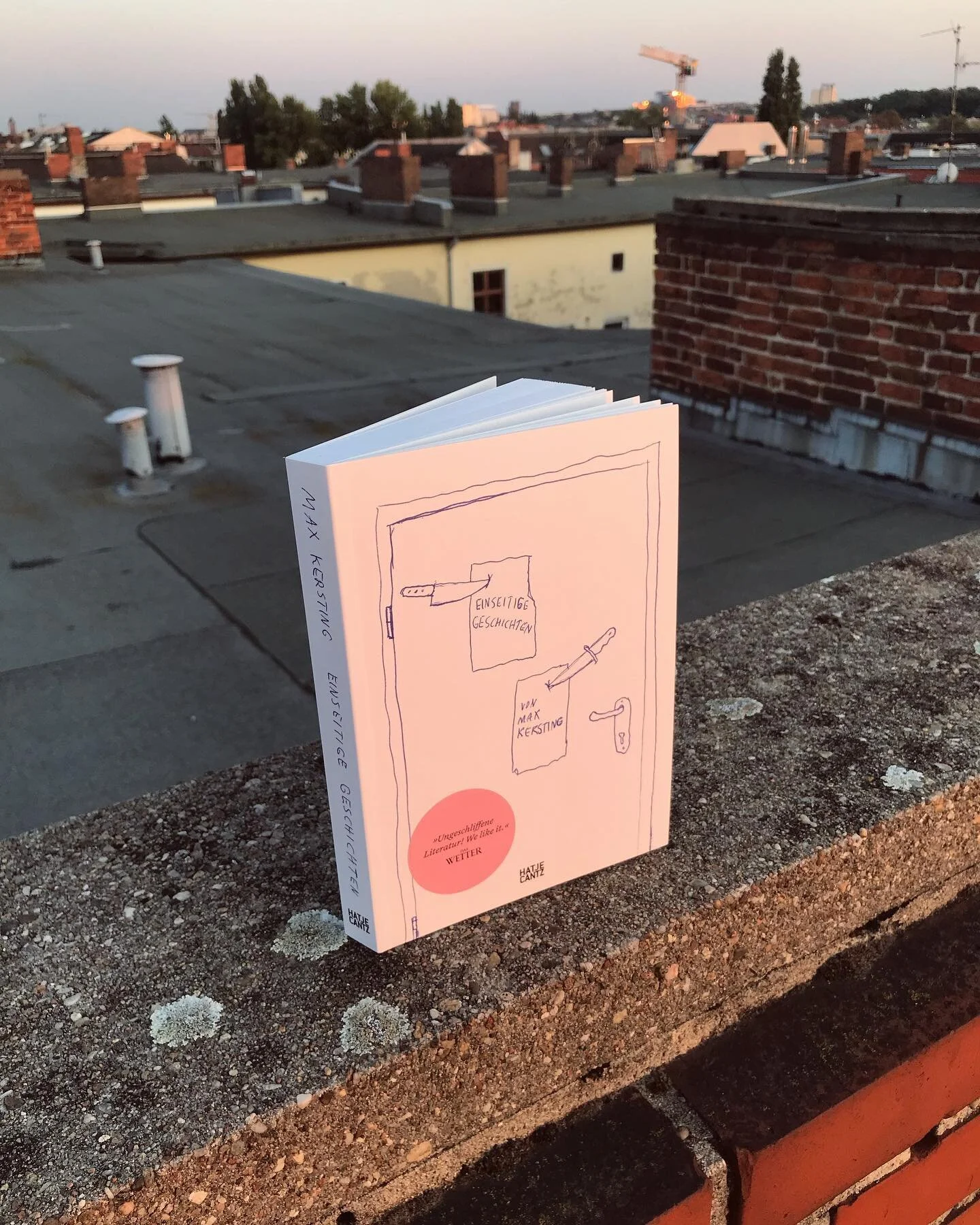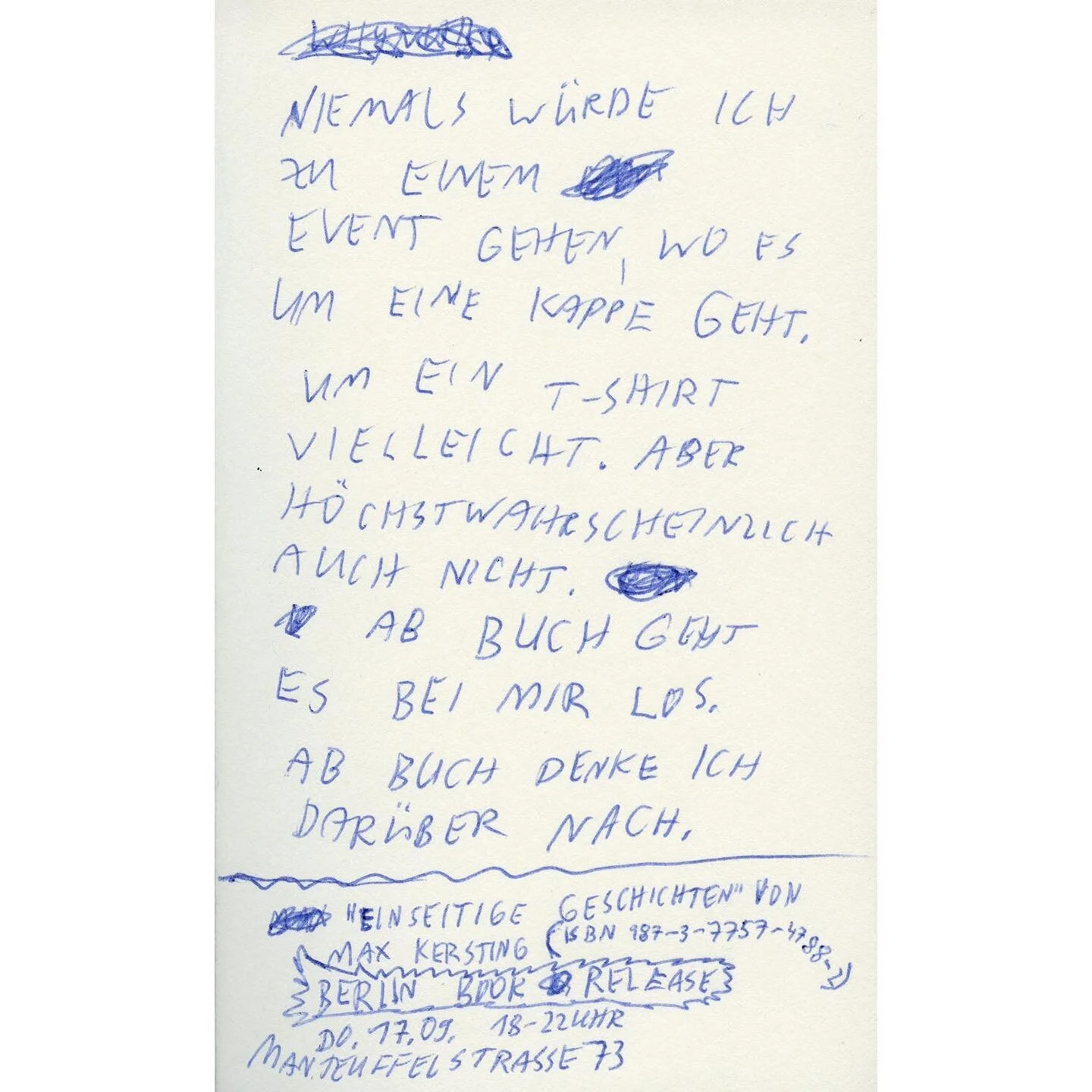1) „Wie funktioniert die Lippstädter Welle?“
Quelle: Versions- und Revisionsbericht Ingenieursbüro Floecksmühle GmbH, 13.11.2019
Für den Betrieb einer stehenden Welle benötigt man Wasser, das durch einen Höhenunterschied beschleunigt wird und dabei auf einen Widerstand stößt. Im Falle der Lippstädter Welle würde für diesen Zweck das Wasser temporär im Oberlauf der Kanustrecke durch die Aufrichtung einer Stauklappe (“Dachventil”) aufgestaut. Über die längere Seite des Dachventils wird das Wasser beschleunigt und trifft auf eine Betonkurve am Streckenboden. Diese Betonkurve würde das Wasser abbremsen, sodass eine surfbare Welle entsteht. Das Dachventil ließe sich aufstellen, bzw.- absenken, sodass zwischen den Einstellungen für den Wellen- oder Kanubetrieb ohne Probleme schnell gewechselt werden könnte. Ist die Welle flach gestellt, ist die Kanustrecke wieder ohne Einschränkung befahrbar.
Die Umstellung zwischen Surf- und Kanubetrieb würde in kurzer Zeit und mehrmals täglich möglich sein!
Ein weiterer Vorteil dieser Planung besteht in den stufenlosen Einstellmöglichkeiten für das Dachventil. Durch Auf- und Absenken ließe sich die Höhe der Welle für alle Wasserstände und Niveaustufen der Surfer einstellen. Dadurch könnten sowohl anfängertaugliche als auch herausfordernde Bedingungen jederzeit gezielt hergestellt werden.
Die Umbaumaßnahme an der Wasserportanlage Stiftsmühle bietet die Möglichkeit eine einzigartige und abwechslungsreiche Sportstätte zu erschaffen. Mit Ausnahme der Energiekosten für den Betrieb des Dachventils ließe sich die Lippstädter Welle im Vergleich zu kommerziellen Wellenprojekten nahezu klimaneutral und sozial gerecht betreiben.
2) „Muss die Welle in die Kanustrecke integriert werden? Warum kann die Welle nicht auch an einem anderen Standort in Lippstadt gebaut werden, z.B. am Tivoli oder auf dem Alberssee?“
Im Jahr 2018 wurden im Auftrag der Stadt Lippstadt 4 verschiedene Standorte innerhalb der Stadt unter die Lupe genommen. Das Ergebnis fiel eindeutig aus. Nur an der Burgmühle finden sich optimale Bedingungen zur Erzeugung einer stehenden Welle. Der Standort bietet so gute Rahmenbedingungen (Fliessgeschwindigkeit / Höhenunterschied / Abflusswerte / Flussbreite etc.), dass - bezogen auf die Qualität der Welle - eine zur Eisbachwelle in München vergleichbare Flusswelle erzeugt werden kann.
Europameisterin im Stationary Wave Surfing auf der Münchner Flusswelle am Eisbach, München (Foto: Janina Zeitler)
Tivoli
Im Vergleich dazu wäre der Standort am Tivoli nur wenig attraktiv und bietet aufgrund des geringen Höhenunterschiedes keine guten Rahmenbedingungen und voraussichtlich weniger mögliche Nutzungstage. Zudem würde die Realisierung am Tivoli eine sehr große Baumaßnahme und damit immens größere Finanzierungsaufgabe bedeuten (Planung, Genehmigungsverfahren, Umsetzung). Inwieweit sich längerfristige Baumaßnahmen auf die Nutzung des Lippetors auswirken würden, lässt sich ebenfalls nicht absehen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass eine geeignete Flusswelle am Tivoli nicht erzeugt werden kann.
Alberssee
Die Realisation einer künstlichen Welle auf dem Alberssee widersprächeunserer Vision einer fast energieneutralen, sozial gerechten und nicht kommerziellen Welle für alle. Eine Anlage auf dem Alberssee könnte nur kommerziell betrieben werden, da der Stromverbrauch einer solchen Anlage enorm hoch ist. Mit Blick auf die bereits bestehenden kommerziellen Anlagen (Langenfeld, Osnabrück) wird deutlich, dass die Nutzung mit mindestens 37€ (vgl. Surf Langenfeld) pro Stunde einer zahlungskräftigen Klientel vorbehalten ist. Wer künstlichen Welle bereits besucht hat, kann bestätigen, dass die effektive Nutzungszeit von einer Stunde ca. 5-7 Versuchen auf der Welle entspricht. Dieses Verhältnis variiert von Projekt zu Projekt lediglich marginal.
Die Citywave, bzw. „Hasewelle“ in Osnabrück (Foto: Citywave® / www.citywave.de)
3) „An wievielen Tagen kann man dann in Lippstadt surfen und kann man auch im Winter surfen?“
Surfen wird man an voraussichtlich ca. 130 Tagen im Jahr bei guten bis sehr guten Bedingungen. Das bedeutet Surfen mit einem Short-Board auf Wettkampfniveau. Vergleichbar ist dies mit der Eisbachwelle (E1) in München, der künstlichen Welle in Langenfeld, oder anderen Varianten (vgl. Citywave Jochen Schweizer München, …).
Mit einem größeren Surfbrett (z.B. Softtop, Malibu Shape, Longboard, SUP) wird es auch an deutlich mehr Tagen möglich sein. Größere Boards eignen sich besonders gut für Anfänger, die Förderung im Jugendbereich und für Kooperationen mit Schulen.
Die Nutzung kann mit entsprechendem Material also weitaus mehr Tage als die festgestellten 130 auf Wettkampfniveau umfassen?
Dieser Fakt ist wichtig zu verstehen, da Kritiker des Projekts häufig mit lediglich höchstens 130 Tagen der Nutzung argumentieren und die Sachlage verkennen bzw. falsch darstellen. Nach einem Bericht des Ingenieurbüros Floecksmühle wird die statistische Nutzungsdauer mit 160 Tagen angegeben (vgl. Bericht Floecksmühle) und bezieht sich dabei auf die Nutzung für “herkömmliche Surfbretter” (vgl. ebd. S.16). Wir sehen eine nennenswerte Ausweitung der Nutzbarkeit über die statistisch möglichen 160 Tage durch Surfbretter mit größeren Volumina (bspw. Longboards und SUP). Die Nutzung von Surfbrettern mit größeren Volumina bietet viele Vorteile: So könnten Kinder und Jugendliche im Rahmen der Jugendarbeit unter sicheren Rahmenbedingungen geschult werden. Es ließen sich Anfängerkurse anbieten und auch geübte Surfer könnten herausfordernde Crosssteps oder Noserides auf einer kleineren Welle üben.
Surfer im Englischen Garten in München
Ein weiterer Einwand wird häufig mit der vermeintlich eingeschränkten Nutzbarkeit guter Bedingungen im Winter gerechtfertigt. Diesen Einwand lässt sich nicht nachvollziehen und mit einem Blick zum Eisbach im Winter entkräften. Neoprenanzüge nehmen Temperaturen ihren Einfluss. Getreu dem Motto „Zu kaltes Wasser gibt es nicht, lediglich falsches Material“ lassen sich Surfer alljährlich bei allen Temperaturen in München beobachten.
4) „Wenn in Werne ein Wave-Park gebaut wird, braucht man die Welle in Lippstadt dann überhaupt noch?“
Der geplante Wave-Park in Werne wird zwar auch künstliche Wellen erzeugen, allerdings sind hierfür hohe Eintrittsgelder und horrende Energiemengen notwendig. Damit eignet sich der noch in Planung befindliche Wave-Park in Werne wunderbar als weiteres Beispiel einer künstlichen Welle, die exklusiv lediglich einem kleinen zahlungskräftigen Klientel vorbehalten sein wird.
Der Verein Lippstädter Welle erkennt insbesondere hier die Möglichkeit, das Surfen allen interessierten Menschen über die Grenzen soziökonomisch bevorteilter gesellschaftlicher Schichten hinaus zu ermöglichen. Dies kennzeichnet ein weiteres Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu kommerziellen Angeboten.
Wir verstehen unser Projekt als Gegenwurf zu elitären Vereinen mit dem Anspruch, das Surfen in Lippstadt vom Trend- zum Breitensport zu entwickeln. Die Planung und Errichtung weitere kommerzieller Wave-Parks sind Indizien für die Nachfrage und Popularität dieser Sportart. Polemisch ließe sich die Frage auch umformulieren: Wenn in Hagen bereits eine Kanustrecke samt Leistungszentrum besteht, braucht man die Kanustrecke in Lippstadt überhaupt noch?
5) „Ist Surfen nicht eine Randsportart für ein paar wenige?“
In Deutschland gibt es ca. 400.000 aktive Surfer und dass, obwohl Deutschland nur sehr bedingt über geeignete Küstenabschnitte verfügt (mit Ausnahme der Nordseeinseln an einigen Tagen im Jahr).
Das Surfen (insbesondere Wellenreiten) erfreut sich weltweit seit Jahren einer stetig wachsenden und nicht zu verkennenden Popularität. So zählt Surfen beispielsweise seit dem Jahr 2020 als neue Olympische Disziplin, es entstehen derzeit deutschlandweit kommerzielle und nicht-kommerzielle Wellenprojekte und die ganzjährige Auslastung bereits bestehender Angebote belegt, dass die wachsende Nachfrage durch entsprechende Angebote derzeit kaum bedient werden kann. Ganz zu Schweigen von der Rolle, die das Surfen für das Bewerben unterschiedlichster (unsportlicher) Produkte zuweilen spielt und als weiterer Beleg dessen gesehen werden kann.
6) Warum “stört“ die Welle die Kanufahrer?
Bei aktivierter Welle würde laut heutiger Planung der Oberlauf der Strecke gestaut und dadurch verlangsamt, der untere Teil der Strecke bliebe davon unbeeinträchtigt. Würde die Welle deaktiviert, hätte sie keinerlei Einfluss mehr auf die Fließeigenschaften der gesamten Strecke. Laut Planungsbüro Hydrostadium – ausgewiesenen und anerkannten Spezialisten für die Planung und Umsetzung (u.a.) von Kanustrecken – würden sich bei deaktivierter Welle keinerlei Einbußen für den Kanubetrieb ergeben!
Jüngst wurden nicht hinnehmbare Umbaumaßnahmen und Anpassungen zwischen den Nutzungen angesprochen und dadurch eine nicht Vereinbarkeit impliziert und durch „bereits betriebene Anlagen“ zu belegen versucht. Beispiele für gescheiterte gemeinsame Nutzungen durch Kanuten und Surfer sind uns, auch nach ausgiebiger Recherche, nicht bekannt. Da dieses Projekt im Euroraum einzigartig ist, stellt sich uns die Frage des Ursprungs der genannten Erfahrungen.
Vielmehr sollte man gemeinsame Nutzung differenziert betrachten: Natürlich ist auch uns bewusst, dass keine gleichzeitige Nutzung durch Kanuten und Surfern mit einem hohen Anspruch an sicherer Nutzung zu vereinbaren ist. Vielmehr verstehen wir unter gemeinsamer Nutzung die Absprache von Nutzungszeiten. So wie es für alle städtischen Sportstätten (z.B. Turnhallen), die gemeinsam von mehreren Vereinen genutzt werden können, üblich und fair möglich ist. Wir verstehen, dass eine gemeinsame Nutzung natürlich auch ein gewissen Verzicht für alle Beteiligten bedeutet. Auf einer Kanustrecke mit ca. 150 Metern Länge auf einem kleinen Abschnitt (ca. 25m für den Streckenabschnitt der Welle, was ca. 17% der gesamten Kanustrecke entspricht) im Sinne der Vielfalt im Sport zu verzichten nennen wir angemessen.
Damit widersprechen wir den Ansprüchen einzelner Vereine, die aus den Bedürfnissen weniger Sportler abgeleitet werden. Insbesondere widersprechen wir auch der Aussage, dass die breit angelegte Nutzung einer Sportstätte einen Verlust darstellt.
Das zukünftige sportliche Erfolge im Kanusport - die bisher wohlgemerkt unter den “spärlichen” Trainingsmöglichkeiten in Lippstadt auch möglich waren - durch eine gemeinsame Nutzung verhindert werden könnten, sehen wir nicht! Scheinbar ist bisher Erreichtes in Zukunft trotz verbesserter Ausgangslage nicht mehr möglich. Diesen Alleinanspruch weisen wir entschieden zurück.
Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang der Lippstädter Welle nicht nur einen negativen Einfluss auf die Strecke zusprechen, denn in der Regel ist es so, dass Strömungsverhältnisse auf solchen künstlichen Wildwasserstrecken nur durch seitlich angebrachte Hindernisse (Obstacles) verändert werden. In Lippstadt hätte man mit der Wellenhydraulik eine zusätzliche Möglichkeit die Strömung in einer weiteren Dimension zu beeinflussen. Ein gestauter Oberlauf bedeutet für den erfahrenen Slalompaddler vielleicht weniger Herausforderung, aber durchaus die Möglichkeit diesen Sport für Kinder zu öffnen. Eine herausfordernde Strecke ist für Athleten zur Wettkampfvorbereitung unerlässlich. Der häufig impliziten genannten Nachwuchsförderung im Jugendbereich des Kanusports entspricht dies jedoch nicht. Die Anforderungen eines Athleten zur Wettkampfvorbereitung können sich in unseren Augen nicht mit den sicherheitsrelevanten Anforderungen zur Förderung im Jugendbereich decken. Die Nutzung der Kanustrecke unter Wettkampfbedingungen ist also wenigen fähigen Athleten vorbehalten, die eine Abstimmung mit dem eigenen Nachwuchs und den Surfern erfordern. Das soll nicht möglich sein?
Wir sehen in der Möglichkeit eines steuerbaren Schwierigkeitsgrades der Strecke lediglich Vorteile für dem Kanu- und Surfsport. Es ist in unseren Augen nur von Vorteil, wenn sich junge Sportler:innen zuerst auf einem Feldweg sicher erproben können, bevor Sie auf einer Formel-1 Strecke ungleich mehr riskieren. Nicht unerwähnt sollte an dieser Stelle ein Statement des Vorsitzenden des Deutsch Kanuverbandes (DKV) bleiben:
“Wir ermutigen deshalb all unsere Slalomvereine, die ja meistens auch andere Wildwassersportarten ausüben, dort wo möglich Surfwellen zu installieren. Das bedarf nicht immer einer großen Investition, sondern manchmal nur den Willen, dies einfach zu machen und die jeweilige Stadt oder Gemeinde vom Mehrwert einer solchen Welle zu überzeugen.”
7) „Ist die Welle nur für Surfer?“
Wer sich im Sommer an der Burgmühle aufhält und einen genauen Blick auf die Nutzung der Sportstätte wirft, erkennt, dass neben vereinzelten Slalom-Kanuten, vor allem auch Kanufahrer in kurzen speziell geformten Kajaks dort trainieren. Diese Kanuten betreiben nicht die Disziplin Kanuslalom, sondern trainieren vorrangig an bereits existierenden stehenden Wellen (bspw. am unteren Schwall), um dort Manöver und Tricks zu üben. Die Welle könnte also durchaus von Kanuten und Surfern genutzt werden. Auch im Verein Lippstädter Welle befinden sich Freestyle-Kanuten (oder “Rodeo-Kanuten”).
Foto: Simon von @riversurfrevival
8) „Wie kann eine gemeinsame Nutzung der Strecke aussehen?“
In den Übergangsjahreszeiten, in denen die Welle voraussichtlich die meisten Nutzungsmöglichkeiten haben wird, beansprucht der WSC die Nutzung offensichtlich nur zu Tageslichtzeiten. Zeitweise wird es im Winter bereits ab 16 Uhr dunkel. Sollte es anwohnerkonform möglich sein, wünschen wir uns eine Beleuchtung im Bereich der Welle und des Ausstiegs, sodass eine Nutzung bspw. von 16-19 Uhr möglich wäre. So wäre eine optimale Auslastung und Nutzung der Strecke möglich, ohne überhaupt Nutzungszeiten des WSC zu verringern. In Anbetracht der Gesamtkosten dieser Strecke wäre dies ein nicht zu unterschätzender Kosten/Nutzen-Faktor.
Darüber hinaus sollte unserer Ansicht nach zuerst in gemeinsamen Gesprächen erörtert werden, welche realistischen Bedarfe zu welchen Jahreszeiten objektiv bestehen. Auf dieser Grundlage ließen sich Kontingente der Nutzung definieren und sowohl dem Leistungssport als auch Jugendsport in den Bereichen Kanu und Surfen zuweisen. Die tatsächliche Nutzung sollte über einen längeren Zeitraum beobachtet und Kontingente neu verteilt werden, sofern dies nötig erscheint.
Weshalb eine geteilte Nutzung der Wassersportanlage an der Burgmühle nicht möglich sein soll, erschließt sich uns bisher nicht. Turnhallen werden ebenfalls von mehreren Sportvereinen genutzt und zeitlich wird die Nutzung aufgeteilt. Dort werden unterschiedlichste Sportarten ausgeübt und lassen sich ebenfalls miteinander vereinbaren. Wir sehen momentan ebenfalls nicht, dass die vorhandene Sportstätte im Rahmen des Leistungssports vollumfänglich ausgelastet wird. Ob solche eine Nachfrage in Zukunft überhaupt bestünde, wagen wir ernsthaft zu bezweifeln. Momentan lässt sich über das Jahr hinweg eine breite Nutzung erkennen, die der angesprochenen Vielfalt entspricht und nebeneinander koexistiert. Kanuten und Surfer verstanden sich im Wasser bereits besser, als von Kritikern oft betont.
9) „Wie ist der aktuelle Stand zur Welle?“
Nach Empfehlung des Sportausschusses der Stadt Lippstadt vom 25.02.2020 und durch Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt vom 07.09.2020 wurde der (Teil-)Finanzierung zur Entwurfsplanung des Büros Floecksmühle zugestimmt. Im Detail bedeutet dies, dass vorbereitende Baumaßnahmen für eine spätere Integration der Welle in die Wassersportanlage “Stiftsmühle” bereits mit beginnendem Umbau umgesetzt werden. Einerseits belegt dieser Beschluss den politischen Willen, das Projekt Welle weiter zu verfolgen und die Hürden für die spätere Realisation zu senken. Andererseits lassen sich durch diese vorbereitenden Maßnahmen die Gesamtkosten für die Nachrüstung der Welle effektiv begrenzen. Die vorbereitenden Maßnahmen entsprechen bereits einem Investitionsumfang von 117.667€ (vgl. Beschlussvorlage 2020, S.6), die sicherlich nicht leichtfertig beschlossen wurden.
10) „Wie teuer ist der Einbau der Welle an der Burgmühle in die Kanustrecke?“
Laut Entwurfsplanung des Büros Floecksmühle wird die Integration der Welle in die Wassersportanlage “Stiftsmühle” gerundet insgesamt 720.000€ betragen (vgl. ebd.). Durch Spenden-, Sponsoring- und Crowdfunding-Aktionen möchten wir einen nicht unerheblichen Beitrag leisten. Beispiele für sehr erfolgreiche Crowdfunding Projekte mit Bezug zum Riversurfing (Surfing-Wolfrathshausen.de) sowie bereits erteilte Spenden und Absichtserklärungen für größere Privatspenden motivieren uns, den Beitrag der Stadt Lippstadt signifikant zu senken.
An dieser Stelle macht es keinen Sinn über zugesagte Spenden und erwartbare Erlöse durch Crowdfunding zu spekulieren. Allerdings ist es dem Verein Lippstädter Welle ein großes Anliegen sein bisheriges Engagement und dessen Reichweite zu bedenken. Wir orientieren uns an bereits sehr erfolgreichen Crowdfunding-Projekten die innerhalb weniger Wochen Jahresziele erreichten.
Als Verein haben wir darüber hinaus die Vision die Betriebs- und Personalkosten für den Betrieb der Sportanlage Burgmühle für die Stadt Lippstadt zu minimieren. So sollen beispielsweise Personalkosten (z.B. Übungsleiterpauschalen, Aufsichten während des Betriebes, etc.) durch Mittel des Vereins getragen werden. Als eingetragener Verein ist es möglich Förderungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Sportbund zu beantragen und zu diesem Zweck zu verwenden.
Unser Konzept (Link) für den Betrieb einer Flusswellen in Lippstadt ist grundlegende Vision und Gedankenspiel zugleich. Wir versuchen hier fortlaufend Antworten auf (neue) Fragen zu einem nachhaltigen Betrieb zu finden und unseren Beitrag dazu als souveräner Verein zu definieren. Unser Ziel ist die Vereinbarkeit unterschiedlicher Sportarten bei der Nutzung einer gemeinsamen Sportstätte zu demonstrieren und zu leben.
11) „Wann könnte man realistisch damit rechnen, die Welle in Betrieb zu nehmen?“
Diese Frage ist sehr schwer bis gar nicht zu beantworten. Aufgrund der Einzigartigkeit dieses Vorhabens sind im Vorfeld zu den Baumaßnahmen alle Beteiligten zu hören und in den Prozess zu integrieren. Derzeit befindet sich die Stadt Lippstadt in einem Abstimmungsverfahren mit dem Land NRW, um die geplanten Bauvorhaben unter Berücksichtigung der erteilten Genehmigung rechtssicher umzusetzen. Konkret bedeutet dies, dass die Stadt Lippstadt eine neue Kanustrecke baut und es rechtlich möglich ist, das Bauwerk Kanustrecke um die gewünschte Welle nachträglich zu erweitern (ohne ein weiteres Genehmigungsverfahren und dessen Ausgang abwarten zu müssen). Sind die genehmigungsrelevanten Fragen ausgeräumt, wird die Baumaßnahme öffentlich ausgeschrieben und im Zuge dieses Verfahrens ein Anbieter mit der Umsetzung beauftragt.
12) „Ist die Welle beschlossene Sache oder noch nicht?“
Der Sportausschuss empfahl dem Rat der Stadt Lippstadt (Februar 2020), dass vorbereitende Maßnahmen für einen nachträglichen Einbau der Welle bereits mit Beginn der ersten Baumaßnahmen umgesetzt werden. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die Gesamtkosten des Projektes so kosteneffizient wie möglich umgesetzt werden können.
13) „Wie kann man den Verein Lippstädter Welle unterstützen?“
Das ist ganz einfach! Werde Mitglied :) Der Verein freut sich immer über neue Mitglieder, oder einfach Menschen die sich für das Thema interessieren und an Aktionen wie den Clean-Up, SUP-Treffen, Surf-Ausflügen etc. teilnehmen.
Du hast eine Frage?
Schreib uns eine E-Mail an: frage@lpwelle.de
Für alle Interessierten zur weiteren Lektüre, hier ein Link zur Beschlussvorlage zur Wassersportanlage "Stiftsmühle" des Sportausschuss vom 25.02.2020.